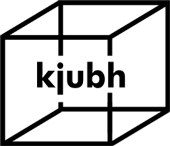12.5. – 16.6.2018
MAN MUSS ES FERTIGBRINGEN, MIT GESPENSTERN ZU WOHNEN
Ich denke, dass Nschotschis Arbeit an eine der Realität immanente Grenze rührt. Die Verzerrungen, die sie zu sehen erlaubt, sind die unserer Welt. Trotz der motivischen Fülle des Dargestellten sind überall Risse und Löcher zu sehen. Man erhält den Eindruck, dass durch sie ein Wind weht. Zwischen den Figuren und dargestellten Elementen, aber auch durch sie hindurch. Es gibt etwas Flatterndes in diesen Zeichnungen, man muss an Märchenwesen denken, deren Mehrwissen sie ausstellen, was sie zu Unheimlichkeitsfiguren macht, die ganz der Immanenz unserer Welt angehören. Nur gehören sie ihr nicht ohne Widerstand an. Ihr Grinsen oder fratzenhaftes Lachen erweist sie als spöttische Realitätsbewohner, die sich weigern, sich in irgendein Ausserhalb zu verziehen. Es sind hexenhafte Wesen, die ohne Märchen auskommen. Auch – und das ist entscheidend – ohne das Märchen Realität! Ihre Kraft beziehen sie aus ihrer Weigerung, nicht hier zu sein. Das verleiht ihnen ihre an der Grenze der Selbstidentität insistierende Monstrosität.
Auch wenn es anders erscheinen könnte: Nschotschis Arbeit ist frei von Symbolen und Metaphern. Das ist der Immanenzcharakter ihrer Skulpturen oder Objekte wie Zeichnungen: Sie entziehen sich ihrer Selbstverrätselung, eben weil sie Rätsel sind! Rätsel sind nicht rätselhaft, sie implizieren keinerlei verborgene Wahrheit. Alles, was sie darstellen, ist die Weigerung, die Evidenzdiktate, die unseren Wirklichkeitsraum konstituieren, zu akzeptieren. Das Hexenhafte hat bereits Gilles Deleuze mit einer Bewegung konnotiert, die das Subjekt einer Linie ins Ungewisse folgen lässt. Hexen reiten auf ihrem Besen ins Nirgendwo. Dabei handelt es sich nicht um eine Flucht ins Bessere, in eine metaphysische Hinterwelt. Im Gegenteil: Die Hexenlinie reißt Löcher ins Bestehende, um dessen originäre Gespenstigkeit zu demonstrieren. Jedes Wissen ist von Phantasmen bevölkert, gelenkt und kontrolliert. Da sind „Bilder, die in uns herumschleichen.“ Alles entscheidet sich am offensiven, statt negativen, Umgang mit ihnen. Man muss es fertigbringen, mit Gespenstern zu wohnen. Sie sind längst da und lassen sich durch keine Wissenschaft verscheuchen, die immer auch Gespensterwissenschaft ist.
Nschotschis Arbeit öffnet sich Gespenstern, sofern wir unter Gespenstern verspielte Inkonsistenzfiguren verstehen. Immer eignet ihnen etwas Groteskes. Am Grotesken verwirrt, dass es ein immanentes Aussen markiert. Grotesk ist, was am Vertrauten unvertraut bleibt. Wenn das Normale sich zur Grimasse verzerrt, wird es grotesk. Es handelt sich um eine Verzerrung, die das Verzerrte als längst verzerrt erweist. Grotesk ist das komische, zum Lachen reizende Moment unserer Realität. Oft handelt es sich um ein Lachen, das in Panik umschlägt. Die Erfahrung des Grotesken kommt einer Verwirrung gleich. Die herrschenden Kategorien geraten ins Wanken. Das Subjekt kommt aus dem Tritt. Es verliert den Halt im Raum der etablierten Evidenzen. Nicht, weil sie aufhören zu existieren, sondern weil ihre Inkonsistenz offenbar geworden ist, ihre Maskenhaftigkeit.
Spätestens seit Nietzsche wissen wir, dass die Maske auf kein stabiles Dahinter, keine substanzielle Wahrheit verweist, sondern deren Inexistenz ausweist. Es gibt nichts als Masken, die sich über Masken legen. Wo ist die Realität? Zweifellos weder im metaphysischen Substanzialismus noch in dessen Entschärfung durchs postmoderne Maskenspiel. Das Groteske verweist auf die komplexe Dialektik von Schein und Wahrheit, Konsistenz und Inkonsistenz. Es geht ums Zittern der Maske. Im Altgriechischen gibt es ein Wort, das Gesicht und Maske gleichermaßen bedeutet: πρόσωπον. Die lateinische persona leitet sich von ihm ab. Es geht um den Menschen, das Subjekt. Es ist Maske einer Maske. Sein Gesicht drückt keine Wahrheit aus. Oder: Es drückt nichts als die ontologische Inkonsistenz der Wahrheit genannten Substanz aus, die als Kardinalreferent unserer Realitätskonstruktionen fungiert.
Vielleicht zeigt Nschotschis Arbeit in den Abgrund einer Maskenhaftigkeit, die unsere Realität ist. Vielleicht können wir von ihr lernen, uns als Maske mit Masken zu identifizieren. Nicht irgendwo und irgendwann, sondern hier und jetzt.