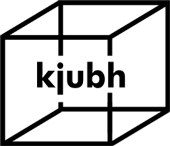Ausstellung 22.3.-26.4.2025
Interview mit Daniela Melotti*
Daniela Melotti
Amèricá?
Stefan à Wengen
Du meinst jetzt die Schreibweise?
Daniela Melotti
Ja, auch. Aber zunächst würde ich gerne wissen, wie Du auf diesen Titel „Amèricá“ kommst.
Stefan à Wengen
Nun, wo soll ich beginnen? Elias Canetti hat einmal geschrieben, dass er nie etwas systematisch gelernt habe, wie andere Leute, sondern nur in plötzlichen Aufregungen. In etwa so, so erinnere ich mich, hatte ich mich immer gefragt, wie es sein kann, dass vieles durch Missverständnisse und Irrtümer Erforschtes zu einer Festschreibung kommen konnte. In dieser Aufregung sozusagen, hatte ich mich dann auf die Suche gemacht und gelernt, dass viele Entwicklungen gleichsam sehr kreativ vonstatten gingen.
Daniela Melotti
Du meinst, dass Kolumbus ursprünglich nach Indien wollte und in Amerika gelandet ist? Beziehst Du Dich auf diesen Irrtum?
Stefan à Wengen
Wir kennen diese Geschichte seit Schulzeiten, dass der italienische Seefahrer in kastilischen Diensten auf seinem Seeweg unwissentlich irgendwo falsch abgebogen war und gleichsam unbeabsichtigt Amerika entdeckte. Beim spanischen Pfeffer war es nicht viel anders; Kolumbus sollte Pfeffersamen zurückbringen, was er auch tat, nur handelte es sich nicht um Pfeffer-, sondern um Chilisamen, woraus schließlich der Name Spanischer Pfeffer entstand. Doch das ist letztlich mehr oder weniger eine falsche Spur, die ich lege.
Daniela Melotti
Sie spielt aber schon auf Missverständnisse und Irrtümer an, die dann übernommen wurden.
Stefan à Wengen
Ja, natürlich. Der 1451 geborene Amerigo Vespucci entdeckte als erster Europäer das damals noch nicht benannte Amerika – Kolumbus wähnte sich ja in Indien –, was wiederum der Dichter Matthias Ringmann, der Vespuccis Reiseberichte gelesen hatte, zu dem Irrtum führte, dass es Vespucci gewesen sei, der Amerika entdeckt habe. Ringmann verfasste die Begleitschrift zur Neuausgabe der „Geographica“ des Kartographen Martin Waldseemüller, nicht wissend, dass er da zuvor etwas falsch gelesen hatte. Waldseemüllers Karten verbreiteten sich jedoch viel schneller, als der Kartograph den dann festgestellten Irrtum seines Kollegen noch hätte korrigieren können. So kam Amerika durch diesen Irrtum zu seinem Namen. Spätere Versuche den Namen Amerika in Kolumbus umzubenennen, führte lediglich dazu, ein Land in Südamerika – also Kolumbien – nach dem einstigen Entdecker, der irrtümlich in Amerika anlandete, zu benennen.
Daniela Melotti
Bei Deiner Schreibweise dachte ich sofort an die deutsche Übersetzung des Romans von T.C. Boyle.
Stefan à Wengen
Und ich hätte Dir schwören können, dass Boyles Roman mit einem Gravis, also mit einem sogenannten Abwärtsakzent auf dem letzten A geschrieben wurde.
Daniela Melotti
Stattdessen ist es ein Akut auf dem E.
Stefan à Wengen
Ja, genau. Und so bezieht sich mein Werktitel „Amèricá“ nicht auf die USA im tatsächlichen Sinne, er bezieht sich vielmehr und unter anderem auf die meist unachtsame Falschschreibung meines Nachnamens. Er ist gleichsam eine Vorführung in Gestalt einer Umkehr der unbewussten oder bewussten Ignoranz in eine vielleicht übertrieben beflissene Korrektschreiberei.
Daniela Melotti
Aber Du hast in jungen Jahren doch auch in Amerika, also in den USA, eine Zeit lang gelebt.
Stefan à Wengen
Dort habe ich dann auch diesen Sehnsuchtsort, den viele Einwanderer oder Eingewanderte mit diesem Kontinent, sowohl dem nördlichen wie auch dem südlichen, verbinden auch selbst erlebt, eine Art Utopia, das die USA natürlich nicht im mindesten erfüllen. Aber eine Fantasie ist eben eine Fantasie, sonst würde sie nicht so heißen.
Daniela Melotti
Ein Wunschtraum.
Wie aber bezieht sich das nun aber auf Dein neues Werk?
Stefan à Wengen
Die kultivierte Idee ist hier die gelebte Melancholie, die sich aus den Lebensjahren ergibt und auch ein bisschen darauf hinweist, wie Kunst entsteht oder entstehen kann.
Daniela Melotti
Der Bezug zur Wahrhaftigkeit, des Wahren in der eigenen Geschichte?
Stefan à Wengen
Amèricá ist eine Art Rückblick, der sich vielleicht auf einstige Sehnsüchte besinnt. Unsere Kultur ist ja sehr geprägt von einem Amerikanismus, aus dessen Versprechen unsere Wünsche und Sehnsüchte zu gründen scheinen. Und da ich nun kein Amerikaner bin, fällt mir die Rolle dieses vermeintlichen Einwanderers zu, der dieses Amerika oder eben Amèricá zu einem Utopia vielleicht verklärt, letztlich aber das individuell Konstitutive meint, all das Erlebte und Ersehnte zusammen.
Daniela Melotti
Als ich einige der Bilder Deiner Serie in einer Reihe an Deiner Atelierwand gesehen hatte, fiel mir sofort auf, dass es sich auch um eine Art Storyline handeln könnte.
Stefan à Wengen
Sehr schön! Die Melancholie dessen liegt auch in deren Format, das Ferne erscheint immer kleiner als die Nähe, sowohl im Rück-, wie im Ausblick. Daher das extrem kleine Format. Und Storyline finde ich einen großartigen Begriff dafür!
Daniela Melotti
Du zeigst auch drei Deiner Schädel, zwei aus Staub und einer aus Stoffasern in von Dir selbst gebauten Vitrinen.
Stefan à Wengen
Der eine besteht aus Staub aus dem Staubsauger aus meiner Wohnung, der andere aus dem Staubsauger meines Ateliers, nachdem ich dort viel mit Kohle gearbeitet hatte. Den Staub habe ich, bevor ich ihn mithilfe eines Bindemittels in die Silikonform gedrückt habe, mindestens eine Woche eingefroren.
Daniela Melotti
Deine Objekte „Homo helveticus“ sehen alle aus wie echte Schädel, obwohl echte Schädel gar nicht so aussehen, doch, wenn man bedenkt, dass wir wieder zu Staub werden, sind sie – auch als Selbstbildnis – dennoch, und im übertragenen Sinn, sehr realistisch.
Stefan à Wengen
Das gilt gleichermaßen für den Schädel aus Stoffasern. Er wirkt letztlich wie mumifiziert, besteht jedoch aus Stofffasern meiner Kleidung, die beim Trocknen abfallen, sozusagen aus meinem Kleiderstaub.
Daniela Melotti
Dementsprechend: Ein Schädel ist ein Schädel ist ein Schädel. – Und doch so viel mehr.
*Das Interview fand im November 2022 statt und wurde im März 2025 ergänzt.